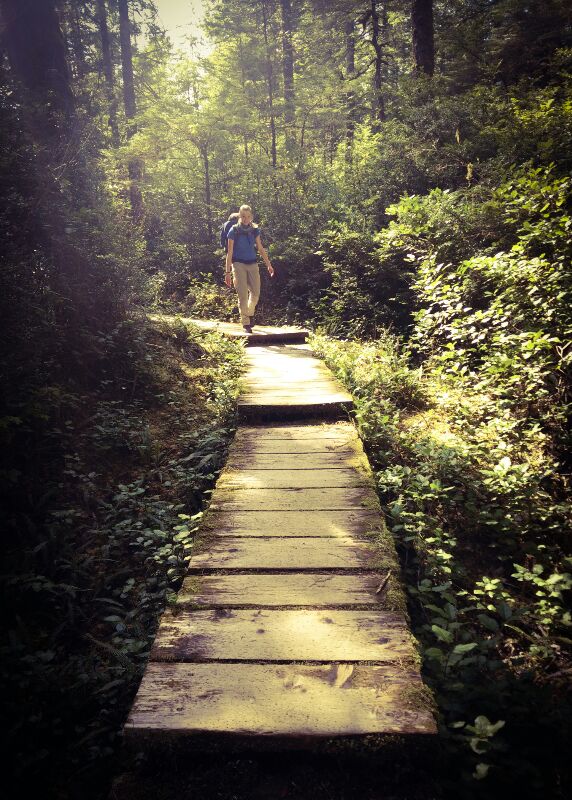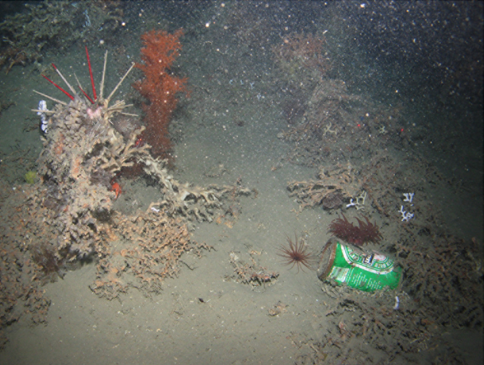An Tag 83 unserer amerikanischen Reise steigen wir in San Diego ins Flugzeug. Allerdings nicht Richtung Europa, schließlich haben wir noch sieben Tage unserer Aufenthaltsgenehmigung auszukosten. Stattdessen fliegen wir über Chicago nach Milwaukee. Die Stadt am Lake Michigan ist das Zentrum des deutschen Amerikas. Es gibt unzählige Brauereien mit Namen wie „Papst“ und „Schlitz“; die Kneipen werben mit einem FC Bayern-Banner für ihre Bundesliga-Übertragungen. Wir sind aber nicht für Fußball und Bier da – wir wollen hier Freunde besuchen. Was in der Praxis dann doch recht viel mit Bier zu tun hat.
Außerdem sehen wir in Milwaukee ein Baseballspiel. Das örtliche Team heißt natürlich Brewers und spielt an jenem Tag gegen die Nationals aus Washington DC. Wir werden Zeuge eines seltenen Ereignisses: Die Brewers gewinnen. Ansonsten ist Baseball ein unglaublich langsames Spiel. Ein unglaublich. langsames. Spiel. Als Zuschauer werden wir daher mit allen möglichen Nebenattraktionen bei Laune gehalten: Da darf man die Zuschauerzahl raten, die Club-Maskottchen liefern sich ein Wettrennen, bei jeder Auswechslung des Pitchers fährt ein Chevrolet durchs Stadion. Die ersten vier Innings sind wir ohnehin damit beschäftigt, uns von Frank die Regeln erklären zu lassen. Schlimm muss es für die Spieler sein, die haben weder Sitzplätze, noch Popcorn, noch Bier. Sie stehen drei Stunden auf dem Rasen und warten darauf, dass der Batter ausnahmsweise mal den Ball in ihre Richtung schlägt. Aber gut, haben sie sich vermutlich mal so ausgesucht. Unser Sport wird es jedenfalls nicht.
Was ich eher gern zu meinem Sport machen würde, ist Segeln. Frank ist Mitglied im Community Sailing Club von Milwaukee und nimmt uns mit aufs Wasser. Leider verlässt uns der Wind in dem Moment, als wir aufs Boot steigen. Nach einer Stunde paddeln durch den Hafen legen wir wieder am Steg an. Abends schauen wir immerhin Videos von Franks Karibik-Törns. Die nächsten Tage aktualisieren wir stündlich den Wind- und Wetterbericht, leider ergibt sich keine Gelegenheit mehr.
Trotzdem haben wir vier schöne Tage in Milwaukee, bevor wir mal wieder in einen Greyhound-Bus steigen und zum großen Finale nach Chicago fahren. Genau rechtzeitig zum Blues Festival. Ein paar Stunden später sitzen wir im Grant Park und hören Shemekia Copeland und Band zu. Hinter der Bühne, über der Skyline, zieht ein Gewitter auf. Als Shemekia über verlorene Liebe in Memphis singt, schlägt ein Blitz in die Antenne des Willis Tower ein, mit 442 Metern höchster Turm Chicagos.
Zwei weitere Ereignisse beschäftigen Amerikas drittgrößte Stadt an diesem Wochenende: Die Chicago Black Hawks spielen im Finale des Stanley Cups um die nordamerikanische Eishockey-Meisterschaft. Und am Samstag Abend steigt der „Naked Bike Ride“. Etwa tausend Menschen fahren, großteils splitternackt, auf Fahrrädern durch die Stadt.
https://www.youtube.com/watch?v=nycTzlUfcmI
Den letzten Abend unserer Reise verbringen wir mit Rebecca und Ryan, zwei Reise-Bekanntschaften aus New York. Die Beiden nehmen uns mit zum John Hancock Building, wo wir in einer Bar im sechsundneunzigsten Stock ein Bier trinken, mit fantastischem Blick über Stadt und See.
Der Heimflug verläuft ähnlich verkorkst wie unsere Hinreise. Aber als wir auf europäischem Boden landen, macht der Pilot eine Durchsage: Während wir in der Luft waren, haben die Black Hawks das entscheidende Finalspiel gewonnen. In der Economy Class bricht Jubel aus.