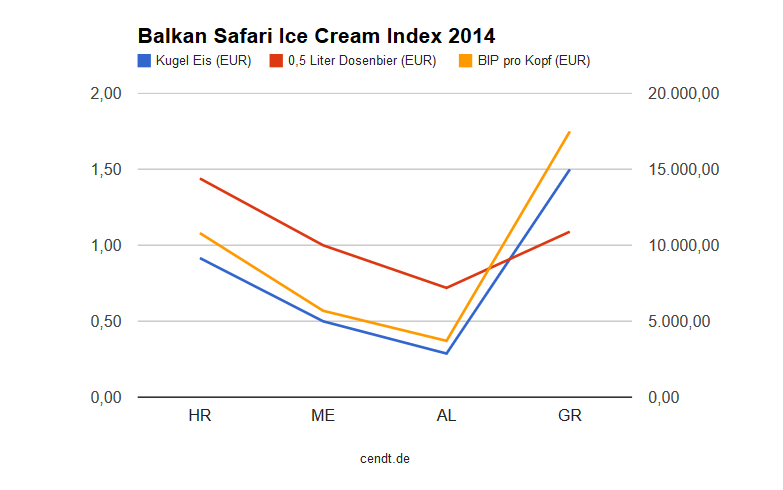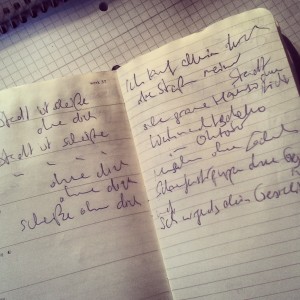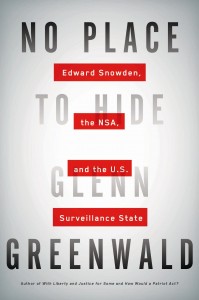Glenn Greenwald: No Place To Hide
In „No Place To Hide“ von Glenn Greenwald steht kaum etwas Neues. Wer die Snowden-Enthüllungen ein bisschen verfolgt hat, kennt den Inhalt schon. Lest es trotzdem.
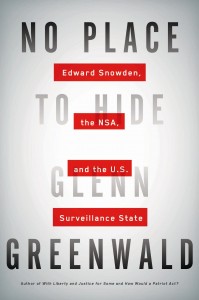
Das Buch (deutsche Ausgabe: „Die globale Überwachung“) beginnnt mit einer Nacherzählung von Greenwalds Zusammenarbeit mit Edward Snowden. Die ersten beiden Kapitel, „Contact“ und „Ten Days in Hong Kong“, sind relativ kurz und spannend wie ein Thriller. Sie handeln von zwei Männern und einer Frau, die für das Gute kämpfen und vor bösen Agenten fliehen. Wäre das sein Spielilm, man würde manche Details für überzogen und unglaubwürdig halten. Etwa wenn Greenwald seine Begleiterin Laura Poitras beim ersten Treffen fragt, woran sie Snowden erkennen würden, und diese antwortet: „He’ll be carrying a Rubik’s Cube.“ Einige Minuten später steht Snowden dann vor ihnen, in der Hand einen Zauberwürfel. Sie gehen auf sein Hotelzimmer, stecken ihre Handys in den Kühlschrank und legen Kissen vor den Türspalt. Dann beginnen Greenwald, Poitras und Snowden mit der Arbeit an den NSA-Dokumenten.
Deren Inhalt behandelt das umfangreichste Kapitel, „Collect It All“. Darin beschreibt Greenwald, wie die NSA-Überwachungsprogramme funktionieren. Das ist eine Zusammenfassung der Enthüllungen, die seit Juni 2013 nach und nach veröffentlicht worden. Dieser Abschnitt ist mit vielen Originaldokumenten aus dem Snowden-Fundus, großteils Powerpoint-Folien, viele davon stümperhaft zusammengebastelt. Der Verlag bietet alle im Buch abgebildeten Dokumente frei zum Download an.
Ein wichtiger Bestandteil ist die Zusammenarbeit mit den großen amerikanischen Internet-Firmen Google, Facebook, Yahoo!, Microsoft und Apple. Die gewähren der NSA umfangreichen Zugriff auf ihre Datenbanken. In Amerika produzierte Router, etwa von Cisco, werden vor dem Export von der NSA abgefangen und mit Spionagetechnik ausgerüstet. Der britische Geheimdienst GCHQ zapft Unterseekabel an.
Viel Raum widmet Greenwald der Frage, was die Geheimdienste mit ihrer Überwachung bezwecken. Die wichtigste Erkenntnis: Es geht nicht um Terrorismus. Ein winziger Teil der Datensammlerei dient vielleicht tatsächlich dem „Krieg gegen den Terror„. Über diese Programme wurden Parlamente und Öffentlichkeit von Anfang an halbwegs informiert. Durch die vorher geschürte Angst vor Anschlägen ist eine gewisse Akzeptanz vorhanden.
Leider bringt die ganze Überwacherei nichts – sie verhindert keine Terrorattacken. Greenwald zitiert diese entlarvende Passage aus einem Gastbeitrag dreier US-Senatoren in der New York Times:
The usefulness of the bulk collection program has been greatly exaggerated. We have yet to see any proof that it provides real, unique value in protecting national security. In spite of our repeated requests, the N.S.A. has not provided evidence of any instance when the agency used this program to review phone records that could not have been obtained using a regular court order or emergency authorization.
Die Überwachung hilft nur nicht dabei, die Welt sicherer zu machen. Sie macht die Welt unsicherer. Denn die Schlupflöcher, die für die Geheimdienste in unsere Kommunkationssysteme eingebaut werden, stehen auch anderen offen.
Aber wie gesagt, um Terrorabwehr geht es eh nicht so wirklich. Die Spionage richtet sich ebenso gegen profane Kriminalität, etwa Drogenhandel. Außerdem dienen die NSA-Programme der politischen und Wirtschafts-Spionage. So wurden etwa im Vorfeld von Gipfeltreffen andere Regierungen ausgespäht, um deren Verhandlungsstrategie auszukundschaften. Auch das Handy von Kanzlerin Merkel steht bekanntlich auf der Liste. Der brasilianische Ölkonzern Petrobas war ebenfalls Ziel der Überwachung.
Der allergrößte Teil der Überwachung geschieht allerdings völlig ohne Grund. Einfach, weil sie’s können. Greenwald schreibt:
Some of the surveillance was ostensibly devoted to terrorism suspects. But great quantities of the programs manifestly had nothing to do with national security. The documents left no doubt that the NSA was equally involved in economic espionage, diplomatic spying, and suspicionless surveillance aimed at entire populations.
[Seite 94]
Oder, wie es Ex-NSA-Chef Alexander ausdrückt: „Collect it all.“
Im Kapitel „The Harm Of Surveillance“ begründet Greenwald, warum Überwachung gefährlich ist. Es gehört zu den großen Seltsamkeiten im Zusammenhang mit den Snowden-Enthüllungen, dass man das immer noch, immer wieder erklären muss. Dass man immer noch an jeder Ecke den Satz hört: „Ich habe nichts zu verbergen.“
Diese Behauptung stimmt fast nie, wie eine aktuelle ZDF-Doku zeigt. Aber selbst wenn, ist sie Quatsch. Klar, wer brav jeden Tag zur Arbeit geht und am Sonntag in die Kirche, wer sein Kreuz in einem der ersten beiden Felder macht und sich sonst aus Politik heraus- und seine Meinung für sich behält, der hat erstmal nicht so viel zu befürchten. Dennoch ist er mitbetroffen, wenn die Freiheit von Journalisten, Oppositionellen, Aktivisten, Andersdenkenden eingeschränkt wird. Denn dann geht die Freiheit der Gesellschaft vor die Hunde. Zum Beispiel ist in Deutschland die Skepsis gegen das Freihandelsabkommen TTIP weit verbreitet. Aber nur eine handvoll Leute engagieren sich dagegen. Eine davon ist Maritta Strasser, der kürzlich die Einreise in die USA verweigert wurde. Greenwald schreibt den eigentlich trivialen Satz:
The true measure of a society’s freedom is how it treats its dissidents and other marginalized groups, not how it treats good loyalists.
[Seite 196]
Ein weiteres Problem ist, dass vor allem Leute jenseits der Vierzig (und die sitzen an den Machtpositionen) das Internet immer noch irgendwie für ein Spielzeug halten und dessen Bedeutung für unsere Welt maßlos unterschätzen. Das ist ein Irrtum. Sascha Lobo sagte kürzlich in einer Rede:
Es geht nicht mehr um Internet-Überwachung, es geht um Welt-Überwachung mit dem Internet.
In einer funktionierenden Demokratie sollte es so sein, dass die Bürger ein Recht auf Privatsphäre haben, die Handlungen des Staates aber für alle transparent sind. Dieses Verhältnis ist inzwischen fast vollständig umgekehrt. In Amerika, aber auch in Deutschland.
Im Epilog schreibt Greenwald von Ed Snowdens großer Sorge: Nämlich, dass sich keiner so recht für seine Enthüllungen interessiert und alles umsonst gewesen ist. Dies sei glücklicherweise nicht eingetroffen.
An dieser Stelle kann ich nicht ganz mitgehen. Klar, die Snowden-Enthüllungen haben riesige Aufmerksamkeit erhalten, haben das Thema Überwachung in den Medien sehr viel präsenter gemacht. Auch politisch tut sich was. In den USA arbeitet der Kongress an einem Gesetz, das die Geheimdienste in ihre Schranken weisen soll. In Deutschland hat ein parlamentarischer Untersuchuchungsausschuss die Arbeit aufgenommen. Aber das US-Gesetz wird in den Ausschüssen bis zur Nutzlosigkeit aufgeweicht. Der U-Ausschuss wird wahrscheinlich folgenlos bleiben wie die meisten vor ihm.
Vor allem aber ist der Bevölkerung das ganze Thema weitgehend egal. Auf persönlicher Ebene passiert nichts, um sich vor Überwachung zu schützen. So ist mein Wechsel von WhatsApp zu Threema gescheitert, da kaum jemand mitgegangen ist. Bei der Bundestagswahl wurden die Parteien wiedergewählt, denen Datenschutz egal ist. Die Piraten sind tot. Auch die Grünen, die mit Ströbele zumindest eine glaubwürdige Spitzenfigur haben, die sich gegen Überwachung engagiert, haben Stimmen verloren. Und so etwas wie wirklicher Protest oder eine Bewegung gegen die unkontrollierte, grenzenlose Macht der Geheimdienste ist weit und breit nirgendwo zu erkennen.
Snowden und Greenwald haben das Thema Überwachung zum Gesprächsthema gemacht. Das ist gut und wichtig. Ihre Enthüllungen sind eine journalistische Meisterleistung und eine bürgerrechtliche Heldentat. Trotzdem sieht es danach aus, als würde sich nichts ändern und die Überwachung weitergehen wie bisher.
Ich denke, es ist ein guter Anfang, dieses Buch zu lesen. Auch wenn nicht viel neues drinsteht. Man kann das Ausmaß dieser ganzen Geschichte so oder so nicht fassen. Aber sie so systematisch, an einem Stück und aus erster Hand erzählt zu bekommen, hilft dabei, ein Gefühl für den Irrsinn zu entwickeln.