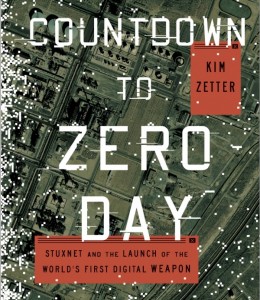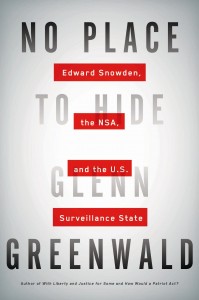Warum wir vielleicht doch ein Smartphone-Problem haben
Vor ein paar Monaten saß ich mit Kollegen beim Mittagessen. Vor mir standen eine Suppe, ein Hauptgericht und ein kleiner Beilagensalat. Ich unterhielt mich mit den Kollegen und begann nebenbei, die Suppe zu essen. Suppe ist ja schließlich eine Vorspeise. Nach zwei oder drei Löffeln schob ich allerdings die Suppe weg und begann, mir Happen des Hauptgerichts auf die Gabel zu schaufeln. Nach wiederum zwei oder drei Bissen kehrte ich zur Suppe zurück. Da hielt ich plötzlich inne.
Offenbar ist meine Aufmerksamkeitsspanne inzwischen so weit herabgesunken, dass ich nicht mehr in der Lage bin zwei Gänge eines Mittagessens hintereinander zu mir zu nehmen, ohne zwischendurch hin und her zu wechseln. Ich finde das nicht gut. Und ich glaube, dieses Defizit, das ich an jenem Tag in der Kantine diagnostiziert habe, liegt an meinem Smartphone-Konsum.
 Im aktuellen Spiegel steht eine Titelgeschichte mit der Überschrift „Leg doch einfach mal das Ding weg!“ (hier gegen Bezahlung lesbar). Darin erzählen mehrere Familien von ihrem Ringen um den richtigen Umgang mit Telefonen und Tablets, die im Alltag eine immer größere Rolle spielen. Vor allem, so der Spiegel, sei das bei Kindern ein Problem.
Im aktuellen Spiegel steht eine Titelgeschichte mit der Überschrift „Leg doch einfach mal das Ding weg!“ (hier gegen Bezahlung lesbar). Darin erzählen mehrere Familien von ihrem Ringen um den richtigen Umgang mit Telefonen und Tablets, die im Alltag eine immer größere Rolle spielen. Vor allem, so der Spiegel, sei das bei Kindern ein Problem.
Mein SZ-Kollege Dirk von Gehlen hat auf seinem Blog eine Antwort auf den Spiegel-Text geschrieben. Darin verteidigt er quasi das Handy gegen die Kritik: Es sei halt eine neue Technologie, mit der man den Umgang erst lernen müsse, kein Grund zur Aufregung.
Ich mag diese gelassene Haltung sehr. Und ich gebe Dirk grundsätzlich recht. An einer Stelle muss ich allerdings widersprechen. Dirk vergleicht in seinem Beitrag das Smartphone mit einem Fahrrad. Auch das sei ja schließlich mal erfunden worden und die Leute hätten erst herausfinden müssen, wie man es benutzt. Daher sei der „Weglegen“-Aufruf auf dem Spiegel-Cover ein schlechter Ratschlag. Schließlich lerne man Radfahren nur durch Radfahren und nicht, wenn das Radl in der Garage steht.
Dieser Vergleich zieht nicht. Ich bin leidenschaftlicher Radfahrer. Radfahren macht mich glücklich. Aber Radfahren arbeitet nicht mit diesem raffinierten Belohnungs-Mechanismus, der Smartphones so verführerisch macht. Diese unzähligen kleinen Benachrichtigungen über neue Botschaften und Likes, wegen derer wir unsere Telefone so oft aus der Tasche ziehen, die spielen schon sehr geschickt mit unserem menschlichen Verlangen nach Aufmerksamkeit. „Wer ist eigentlich auf die Idee mit dem Drogenvergleich gekommen?“, frägt Dirk. Nunja, natürlich sind Smartphones kein Heroin, aber auf hormoneller Ebene kann ich gewisse Parallelen erkennen.
Daher ist es schon ein wichtiger Teil des Damit-umgehen-lernens, sich nicht abhängig zu machen von diesem Belohnungssystem. Ich versuche mir seit dem Suppen-Erlebnis, bewusst Auszeiten zu nehmen, eine Stunde, einen Tag, demnächst ist eine Woche geplant. Ich finde, das tut mir gut.
In einem Punkt gebe ich Dirk allerdings recht. „3. Wieso muss eigentlich stets die Jugend als Schreckensszenario herhalten?“ frägt er im Bezug auf die Spiegel-Geschichte. Nach meiner Beobachtung sind die schlimmsten Smartphone-Missbraucher keine Jugendlichen, sondern vielmehr Eltern, die ihrem Gerät mehr Aufmerksamkeit schenken als ihren Kindern. In der S-Bahn saß neben mir einmal eine junge Mutter mit ihrem Sohn, der vielleicht vier oder fünf Jahre alt war. Ein unglaublich wacher, neugieriger Kerl. Er sah die ganze Zeit aufgeregt zum Fenster hinaus und stellte kluge Fragen zu den Dingen die er sah, zu Gebäuden, Gleisanlagen, Menschen auf dem Bahnsteig. Ich verstehe schon, dass so ein Kind für seine Eltern ziemlich anstrengend sein kann. Aber diese Mutter, die kaum aufsah, immer nur knappe Antworten hinwarf und wieder in ihrem Telefon versank, hat mich sehr, sehr wütend gemacht.
Als meine Eltern mir Radfahren beibrachten, waren sie selbst schon ziemlich gut darin und konnten mir zeigen, wie es geht. Bei Smartphones und den heutigen Eltern bin ich mir da nicht so sicher.
Vielleicht hat Dirk recht und wir als Gesellschaft haben kein großes Smartphone-Problem. Ich persönlich habe schon eines, fürchte ich. Und vermutlich bin ich damit nicht der einzige.